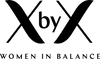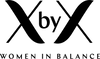Die unendliche Endlichkeit - Oder „The Best is yet to come“

Das Beste kommt noch. Ich liebe diesen Satz. Weil er so hoffnungsfroh ist, positiv - voller Optimismus. Weil er einen gelassen in die Zukunft blicken lässt.
Das Beste kommt noch. Wer will das nicht hören. Erst recht, wenn man inzwischen fast alle vier Wochen kritisch den eigenen Haar-Ansatz beäugt, nach Anzeichen für Hautalterung sucht (und diese auch leider findet) und die Waage…. aber lassen wir das.
Das Beste kommt noch. Ich hasse diesen Satz auch. Weil er einen immer weitertreibt. Raus aus dem Augenblick. Weg vom Moment. Er hetzt einen nach vorne. Nimmt einem die Zeit, dass „Hier und Jetzt“ zu genießen. Hält einem die Möhre vor die Nase, nach der wir immer weiter streben.
Ein Rückblick
Rückblick: Als ich so Anfang zwanzig war, habe ich mir mich gerne selbst um die Jahrtausendwende vorgestellt. Immer schien es mir so, als ob mir eine entspannte, erwachsenere Version meiner selbst entgegen lächeln würde: eins mit sich und ihren Entscheidungen im Leben. Sicher in ihrer Wahl des Partners, des Jobs, des Zuhauses und natürlich mit lieben, aufgeweckten Kindern, die fröhlich durch den schicken, aber dennoch nicht sterilen Lebensmittelpunkt toben. Sozusagen die Hochglanz-Magazin-Version meiner selbst.
Ehrlich gesagt: ich warte immer noch auf diese erwachsenere Version. Jetzt stelle ich sie mir vor, nachdem das einzige Kind, das ich übrigens allein erziehe, aus dem Haus ist. Wobei ich gar nicht so wild darauf bin, dass das schnellstmöglich geschieht - im Gegenteil. Aber das ist der nächste Abschnitt im Leben, der irgendwann auf mich zukommt. Diese gelassene, weise, (hoffentlich schön) gealterte Version meiner selbst, die sich nicht mehr darum kümmern muss, dass die Miete reinkommt, das Auto abbezahlt wird und alle einen vollen Kühlschrank haben. Die sich nicht morgens darüber auseinandersetzen muss, warum an einem Dauerregen-Tag Gummistiefel eine sinnvolle Fußbekleidung sind. Die einen wunderbaren Freundeskreis hat, sportlich ist, ihren Kleidungsstil endgültig gefunden hat, gesunde Mahlzeiten auch für sich allein kocht und mir - Du ahnst es - entspannt und lächelnd entgegen lächelt.
Ist es genauso ein Trugbild wie das in der Mitte meiner Zwanziger? Und wenn ja, wieso entwickele ich diese Bilder? Ich habe bislang nur eine Erklärung. Das ist die „Wenn erst… dann…“-Formel. Die wurde uns doch immer eingebläut. „Wenn Du es erst auf Gymnasium geschafft hast, dann hast Du alle Wahl-Möglichkeiten für Deinen zukünftigen Berufswunsch.“ „Wenn Du dieses Jahr eine eins in Mathe hast, dann darfst Du auch den Reiterferien-Kurs buchen.“ „Wenn Du 18 bist, kannst Du das selbst entscheiden.“ Oder viel kleinteiliger: „Wenn Du heute mithilfst, die Garage aufzuräumen, gehen wir Dir morgen auch die Turnschuhe kaufen, die Du Dir so sehr wünscht.“
Wir - oder zumindest viele von uns - wurden auf die Zukunft getrimmt. Was wir nicht gelernt haben: Im Moment glücklich zu sein. Ihn „Einfrieren“ zu lassen. Ihn überhaupt wahrzunehmen. Und so hetzen wir von der Grundschule zum Gymnasium, vom Abi zum Bachelor zum Master, vom Junior im Job zum Senior im Job und vielleicht in irgendeine Führungsetage. Oder auch nicht, wenn wir, wie die meisten Frauen, eine Kinderpause einlegen bzw. aufgrund der miserablen Kinderbetreuungsangebote einlegen mussten. Und so leben wir teilweise so, als ob wir noch mindestens 3000 Jahre vor uns haben.
Ich hatte genau eine Zeit im Leben, in der ich nicht zumindest unbewusst auf irgendetwas hingearbeitet oder auf irgend etwas gewartet habe: das waren die ersten drei Monate im Leben meines Sohnes. Ungefähr. Nie war ich mehr eins mit dem Moment. Mit diesem winzigen Wesen, das ich mir so innig über Jahre gewünscht hatte. Auf das ich so sehr gehofft hatte. Um mich herum Chaos? Jeden Tag Besuch in der Bude, die ihn alle sehen wollten? Es war mir egal. Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Da war nur dieses Wesen und ich. Was für eine magische Zeit.
"Wenn-dann"
Irgendwann aber schlich sich auch bei mir wieder, „Wenn-dann“ ein. Wenn erst die Koliken vorbei sind, dann können wir lange Ausflüge unternehmen. Wenn der Schatz erst im Kindergarten ist, habe ich mehr Zeit für alles andere. Wenn das Kind endlich Fahrradfahren kann, könnte er mich beim Joggen begleiten. Wenn ich erst andere Aufträge bekomme, wird der Alltag besser. „Das Beste kommt noch“ wurde erneut zum Fluch der Gegenwart.
Bis ich nachts nicht schlafen konnte, weil ich dachte, dass ich meine Wohnung verlieren würde. Und ich einen entscheidenden Satz las: „Wir schreiben jeden Tag ins Tagebuch unserer Kinder.“ Ja, dachte ich. Genauso wie wir jeden Tag in unser eigenes Tagebuch schreiben. Was steht da drin? Wieder von A nach B gehetzt und abends im Bett froh gewesen, dass der Tag vorbei ist? Wieder darauf gehofft, dass endlich Freitag ist? Wie beschämend. Wie oberflächlich. Und wie undankbar, wenn man gesund ist, und dieses (s.o.) liebe, aufgeweckte und fröhliche Kind hat.
Glücklicherweise ertappe ich mich jetzt häufiger beim „Wenn, dann.“ Versuche innezuhalten. Kann sogar inzwischen im Auto zehn Minuten meditieren. Eine Auswirkung des Älterwerdens? Super! Her damit! Mehr davon.
Heute weiß ich (auch wenn ich es nicht immer schaffe, das in jedem Moment zu realisieren):
Beides geht. Das Beste kommt noch. Und jetzt ist es auch schon echt wahnsinnig schön.